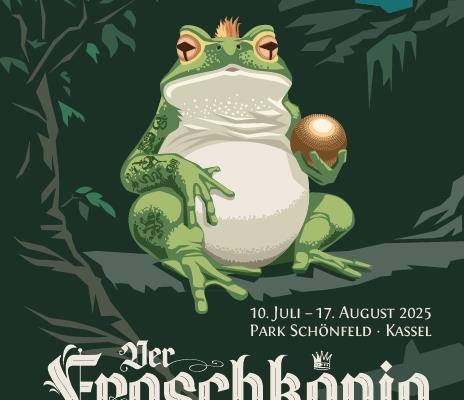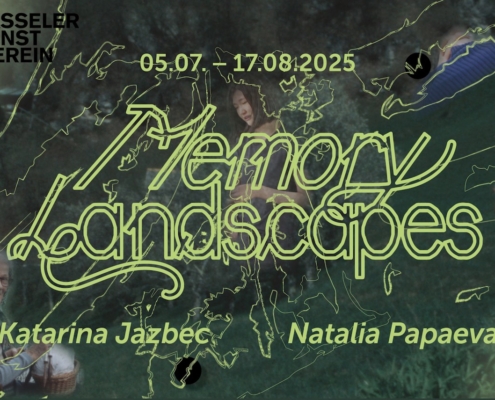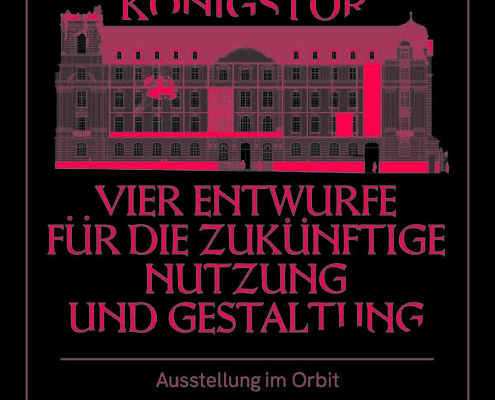https://mittendrin-kassel.de/wp-content/uploads/2025/07/logo_mensch_medien_web.png
1024
1024
Klaus Schaake
https://mittendrin-kassel.de/wp-content/uploads/2019/10/logo-m.png
Klaus Schaake2025-07-17 20:27:342025-07-17 20:46:05Gemeinnütziger Journalismus: Marius Münstermann von CORRECTIV im Gespräch
https://mittendrin-kassel.de/wp-content/uploads/2025/07/logo_mensch_medien_web.png
1024
1024
Klaus Schaake
https://mittendrin-kassel.de/wp-content/uploads/2019/10/logo-m.png
Klaus Schaake2025-07-17 20:27:342025-07-17 20:46:05Gemeinnütziger Journalismus: Marius Münstermann von CORRECTIV im GesprächEin Gespür dafür entwickeln, was an der Zeit ist
Stadtzeit Interview mit Prof. Dr. Mike Sandbothe, Medienphilosoph und Professor für Kultur und Medien
Um zukunftsbildend mit uns und der Welt umgehen zu können, brauchen wir erweiterte Kompetenzen. Es gibt eine neuartige Synthese aus Achtsamkeitsübungen, die in einem Lernprozess individuelle, soziale und ökosystemische Bewusstseinsbildung ermöglichen.
Sie bezeichnen sich selbst als „Bildungspionier für gesundes
Lehren und Lernen“. Wie kam es dazu?
Mein Engagement richtet sich darauf, Menschen zu verbinden, deren Interesse es ist, Bildung gesundheitsförderlich zu transformieren. Einige Dimensionen des menschlichen Seins finden an der Hochschule noch keinen Ort. Zunächst ist das für mich der sich bewegende Körper. Mit der Feldenkrais-Technik, die als Körperpraxis für Bewusstheit durch Bewegung steht, begann ich, eine kontemplative Bewegungsmethode in verschiedenen Studiengängen zu lehren. Die Rückbindung des Geistes an den eigenen Körper ist eine enorm wichtige Erfahrung. Der Körper ermöglicht Zugang zu einer anderen Form von Wissen, die direkt neben dem Wissenserwerb durch Bücher steht.
Was können Sie von konkreten Rückmeldungen Ihrer Student:in
nen berichten?
Gerade Studierende der Informatik fanden es spannend, über den Körper Zugang zu ihren geistigen Zuständen zu gewinnen. Der Körper war für sie wie ein Betriebssystem, mit dem sie arbeiten konnten. Sie erkannten, dass Körperbewegung und Körperbewusstheit auf die Funktionsweise ihres Gehirns wirkten, welches sie wie einen Computer gesehen haben, den sie so optimieren konnten. Ich entschied, dieses Feld systematisch anzugehen und nannte es „Gesundes Lehren und Lernen“, eine Bildung, die sich nicht allein auf kognitives Wissen begrenzt, sondern im Idealfall gleichwertig Erfahrungs- und Körperwissen mit in die Bildungskultur aufnimmt.
Welche Motivationen gaben Ihrer Pionierarbeit den dafür not
wendigen Anschub?
Unsere Achtsamkeitstrainings entstanden auf einer fundierten wissenschaftlichen Basis mit dem Anspruch, leicht zugänglich zu sein. So können sie in verschiedenen gesellschaftlichen Zusammenhängen wirkungsvoll eingesetzt werden. Dafür gibt es viele gute Gründe. Ein Aspekt ist die rasante technologische Entwicklung, die im Spannungsfeld mit einer wesentlich langsameren Bewusstseinsentwicklung beim Menschen steht. Auch das Potenzial von Achtsamkeit in Bezug auf reaktives Verhalten, politische Verantwortung und Konfliktfähigkeit liegt auf der Hand und lädt ein, sich für diesen persönlichen und kollektiven Lern- und Erfahrungsweg zu öffnen.
Worauf beziehen Sie sich in Ihren Grundlagen?
Es gibt Traditionen, die seit jeher Körper und Geist miteinander verbinden. Für die Achtsamkeitsprogramme wählten wir verschiedene Quellen: MBSR, Mindful Based Stress Reduction nach Jon Kabat-Zinn, ein säkulares Achtsamkeitstraining, Vipassana, eine buddhistische Einsichtsmeditation und Yoga, ein ganzheitliches Lebenskonzept. Dazu Methoden unserer Zeit: Dyaden, eine meditative Gesprächsform und SPT, Social Presencing Theater als Gruppenprozess aus der „Theorie U“ von Otto Scharmer und Arawana Hayashi.
Welche konkreten Ergebnisse entstanden daraus in Ihren For
schungsprojekten?
Ein etabliertes Beispiel ist der „Achtsamkeitspfad für Studierende der Sozialen Arbeit“. Die Student:innen erwerben wertvolle Kompetenzen für ihre beruflichen Anforderungen. Dazu gehören Selbstfürsorge und einfühlsame Präsenz ebenso wie die Fähigkeit des empathischen Zuhörens und die Wahrnehmung des sozialen Feldes. 2023 veröffentlichten wir unser Buch „Achtsamkeiten“. Es stellt ein Programm vor, das gut in Schulen und Organisationen integriert wer den kann. Das Trainingsprogramm führt in zwölf Übungen vom persönlichen Körperwissen zum sozialen Körperwissen.
Ein Zitat vom Bucheinband: „Achtsam sein heißt: ein Gespür da
für entwickeln, was an der Zeit ist, und dazu beitragen, dass es
geschehen darf. Zur kulturellen Transformation wird das beson
ders in Krisenzeiten dringend benötigt. Probiere es einfach aus! Wie kann ich mir das vorstellen?
Achtsamkeit beginnt beim Einzelnen, setzt sich fort in Übungen zu zweit, in denen die Beziehung zu anderen Menschen in einer Art Gesprächsmeditation, der Dyade, deutlich wird. So öffnet sich eine höhere Ebene des Körperwissens. Dieses ermöglicht in Gruppenprozessen das soziale Feld achtsam wahrzunehmen. Die Teilnehmenden erleben, wie sich ein berufliches Umfeld oder ein systemischer Komplex genau und konkret anfühlt. Sie entfalten die Präsenz, über den eigenen Körper mit seinen individuellen Prägungen hinaus, Blockaden in einem System, dessen Teil sie sind, sichtbar und spürbar wer den zu lassen. Diese ökosystemische Praxis lässt uns die Lebendigkeit eines sozialen Körpers und sogar eines Ökosystems erkennen. Das kann erlernt, erfahren und integriert werden. Es öffnet sich ein tiefes Empfinden von Verbundenheit mit dem Leben. Das macht Hoffnung!

Prof. Dr. Mike Sandbothe
18.07.2025
„Achtsame Hochschulen“ und von Achtsam.Digital.
>>hier zu lesen