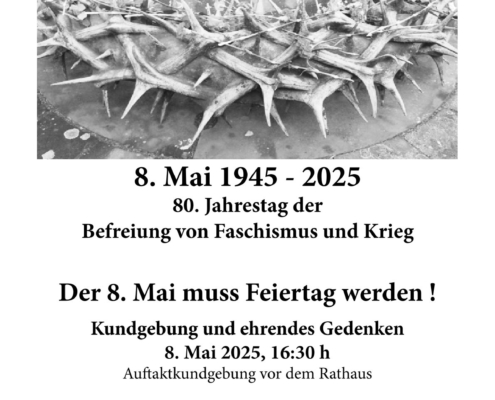Initiative Gedenkort Königstor
https://mittendrin-kassel.de/wp-content/uploads/2025/08/SP-Koenigstor_OpenHouse_1.png
839
819
Silke Bremer
https://mittendrin-kassel.de/wp-content/uploads/2019/10/logo-m.png
Silke Bremer2025-08-04 11:46:472025-08-04 11:46:47Solidaritätsfest am Orbit
Initiative Gedenkort Königstor
https://mittendrin-kassel.de/wp-content/uploads/2025/08/SP-Koenigstor_OpenHouse_1.png
839
819
Silke Bremer
https://mittendrin-kassel.de/wp-content/uploads/2019/10/logo-m.png
Silke Bremer2025-08-04 11:46:472025-08-04 11:46:47Solidaritätsfest am OrbitLisa – ein Kind in weißer Normalität
Diese Geschichte ist Fiktion, aber sie erzählt Wahrheiten. Die Erlebnisse der Figuren beruhen auf dem, was mehrere Kinder tatsächlich durchlebt haben. Manche Situationen wiederholen sich, manche Gefühle sind universell. Aus vielen wahren Geschichten wurde eine einzige, um etwas Größeres zu erzählen
Wenn Lisa morgens zur Schule geht, trägt sie mehr als nur ihren Ranzen. Es liegt auch etwas auf ihrer Seele – etwas Schweres, das sich nicht einfach ablegen lässt. Es ist das bedrückende Gefühl, nicht dazuzugehören, obwohl sie doch nie woanders war als hier.
Lisa wurde 2015 in Kassel geboren. Für ihre Eltern war sie von Anfang an ihr größtes Glück. Schon als Baby war sie fröhlich, lebendig und offen. Lisa hat Eltern unterschiedlicher Hautfarbe. Ihr Vater ist Schwarzer Deutscher, ihre Mutter ist Weißdeutsche. Weil der Vater beruflich sehr viel unterwegs ist, kümmert sich überwiegend die Mutter um die gemeinsame Tochter.
Die ersten drei Jahre in Lisas Leben waren unbeschwert. Sie mochte selbst gemachte Waffeln mit Sahne und freute sich an Ostern auf die Eiersuche und das Eierfärben. Sie liebte das Weihnachtsfest mit dem leuchtenden Baum im Wohnzimmer und den Gänsebraten mit Klößen und Rotkraut am ersten Weihnachtstag. All die Rituale, die für sie genauso dazugehörten wie für viele andere Kinder auch, ließen ihre Augen strahlen.
Die Kita-Zeit veränderte Lisa
Mit drei Jahren kam Lisa in den Kindergarten. Schon in den ersten Tagen spürte sie, dass etwas anders war – nicht an ihr, sondern an der Art, wie man ihr begegnete. Eltern anderer Kinder beugten sich zu ihr herunter, fragten mit forschendem Blick: „Woher kommst du?“ – „Ich komme aus Kassel.“ – „Nein, woher kommst du wirklich?“ Diese Fragen hörte sie immer wieder, und nur sie wurde so gefragt. Und es ging immer weiter: „Wo kommt dein Papa her?“ – „Kannst du mich verstehen?“ – „Sprichst du unsere Sprache?“ Geboren in Kassel, aufgewachsen in einer deutschsprachigen Familie – und dennoch wurde ihre Zugehörigkeit bezweifelt. Lisa war darüber sehr traurig, und die Frage nach dem „Warum“ ließ ihr keine Ruhe.
Und es blieb nicht bei den Fragen. Bei den Begegnungen mit wechselnden Erzieher:innen und anderen Eltern griffen fremde Hände immer wieder in ihre Haare. Sie mochte das nicht und dachte dabei: Was haben diese Leute wohl vorher angefasst? Sie fühlte sich oft wie ein Tier im Streichelzoo, nicht wie ein Mensch. Einmal, auf dem Sommerfest der Kita, als gleich zwei Erwachsene hintereinander in ihre Haare griffen, weinte sie deswegen. Als sie sich einem Erzieher anvertraute, sagte dieser nur: „Das ist doch nicht so schlimm, die Leute sind doch nur neugierig.“ Aber Lisa wollte das nicht akzeptieren. Warum sollte sie Verständnis für etwas aufbringen, das andere Kinder nie über sich ergehen lassen mussten? Ihre Mutter versuchte, sie zu trösten, indem sie von „Interesse an ihren Haaren“ und von „krausem Haar“ sprach, welches nun mal besonders sei. Doch Lisa begriff nur eins: Ihre Haare waren offenbar falsch. Passend dazu hörte sie zufällig und unbemerkt ein Gespräch zwischen ihrer Mutter und einer Nachbarin. Darin beklagte ihre Mutter, dass die Haare ihrer Tochter „störrisch“, „schwierig“ und „kaum zu bändigen“ seien. Da wusste Lisa: Ihre Haare sind ein Problem – und damit vielleicht auch sie selbst.
Die Grundschulzeit war für Lisa extrem belastend
Schon in den ersten Wochen nach ihrer Einschulung verlor Lisa jeden Tag ein Stück mehr von ihrer Lebensfreude. Aus dem einst glücklichen Mädchen wurde allmählich ein trauriges und unglückliches Kind. Lisa wurde beleidigt, verspottet und übergriffig berührt. Eine Mitschülerin sagte: „Du siehst aus wie Schokolade.“ Ein anderes Kind rief: „Wir mögen keine braunen Menschen!“ Auf dem Schulhof nannte sie ein Junge „braune Kackwurst“, und die anderen lachten. Solche Geschehnisse ereigneten sich nicht täglich, aber oft genug, um schmerzhaft in Erinnerung zu bleiben.
Als Lisa sich hilfesuchend an ihre Klassenlehrerin wandte, sagte diese nur: „Lass dir das nicht zu Herzen gehen, es ist von den anderen Kindern nicht böse gemeint.“ Nach der Schule versuchte ihre Mutter, sie mit ähnlichen Worten zu trösten: „Die Kinder wollen dich doch nur ärgern.“ Niemand schien zu begreifen, wie weh das tat. Für Lisa war es mehr als nur kindliches „Ärgern“ oder gegenseitiges „Aufziehen“ – die Worte schnitten tiefer.
Lisa sah auch, was nie über sie gesagt, aber ständig sichtbar wurde: Auf allen Aushängen und Auslagen in der Schule waren nur blonde Kinder zu sehen. Im Kunstunterricht wurden ausschließlich rosa-beige Stifte als Hautfarbenstifte bezeichnet, und als sie einmal bei einem Spiel in der Pause auf einen braunen Bilderrahmen zeigte und „Hautfarbe!“ sagte, lachte ihre Mitschülerin laut: „Das ist doch keine Hautfarbe!“ In der Schulbibliothek waren alle Hauptfiguren in den Geschichten der Bücher nicht wie sie. An ihrer Schule gibt es mehrere Kinder, die ihr ähneln. Sie sind da, aber von schulischer Seite werden sie nicht mitgedacht.
Unter all den Umständen litten auch ihre schulischen Leistungen, was den Mitschüler:innen weiteren Stoff für rassistisch gefärbtes Mobbing bot. Schließlich wollte das kluge und einst fröhliche Mädchen nicht mehr zur Schule gehen. Nach den Wochenenden nässte sie sich oft in den Nächten zum Montag hin ein und litt zudem häufig unter starken Bauchschmerzen. Schlimm ist für sie nun auch die Vorweihnachtszeit, weil zu dieser Zeit auf ihrem Schulweg immer zig Plakate von Spendenorganisationen aushängen, auf denen Schwarze Kinder als arm, bemitleidenswert und hilfsbedürftig dargestellt werden. Die Kinder auf dem Schulweg rufen dann laut: „Die sehen alle aus wie Lisa!“ und lachen dabei. So verlor das Mädchen auch die Freude am Weihnachtsfest.
Fragen, die Lisa zu einer anderen machten
„Warum bist du braun?“ „Warum sprichst du so gut Deutsch?“ „Lebt ihr in Afrika in Hütten?“ All diese Fragen hatten eines gemeinsam: Sie machten Lisa zu einer anderen. Zu einem Kind, das nicht dazugehört, obwohl sie sich immer zugehörig gefühlt hatte. Doch mit der Zeit schlich sich ein Gefühl in ihr Herz: Vielleicht bin ich wirklich anders. Vielleicht bin ich falsch. Vielleicht bin ich nicht genug.
Selbsthass durch Andersmachung
Zum Ende des zweiten Schuljahres schrubbte Lisa sich die Haut, bis sie wund war. Sie wollte den „Schmutz“ abwaschen. Kurze Zeit später schnitt sie sich ihre Haare ab – nicht, weil sie einen neuen Stil wollte, sondern weil sie „solche“ Haare nicht mehr mochte. Im Sommer trug sie keine kurzen Kleidungsstücke mehr, sie wollte ihre Haut verstecken. Doch auch das brachte ihr keine Ruhe, im Gegenteil: „Ihr ist im Sommer kalt, weil sie aus Afrika kommt!“ – wieder Gelächter, wieder Ausgrenzung. Sie stemmte sich gegen diese Ausgrenzung, denn sie wollte dazuzugehören. Doch mit jedem ihrer Schritte wurde ihr seelischer Schmerz unerträglicher, und in ihrem Inneren brach sie Stück für Stück.
In der Mitte des dritten Schuljahres wurden die Eltern von der Klassenlehrerin zu einem Gespräch eingeladen. Lisas Versetzung in die vierte Klasse galt zu diesem Zeitpunkt als gefährdet. Glücklicherweise konnten die Eltern ihr eine private Nachhilfe ermöglichen. Die Nachhilfelehrerin lobte Lisas ausgeprägte Auffassungsgabe und verstand nicht, weshalb sie in der Schule Probleme hatte. Ohne die Nachhilfe hätte Lisa die Grundschule vermutlich nicht geschafft, doch längst nicht alle Familien können sich solch eine Unterstützung leisten.
Lisa lebt in Kassel. Sie kennt keinen anderen Ort. Und doch hat sie früh gelernt, dass sie hier nicht willkommen ist – jedenfalls nicht so, wie sie ist. Die Botschaften kamen und kommen nicht nur von Kindern, sondern von Erwachsenen, von Pädagog:innen, von Strukturen, von der Sprache. Von einem Bildungssystem, das weiß ist – in seinen Bildern, seinen Normen, seinen Maßstäben.
Demokratie auf dem Prüfstand: Wird Kassel den eigenen Ansprüchen gerecht?
Mit gleich zwei Beschlüssen des Kasseler Stadtparlaments verpflichtete sich die Stadt im Jahr 2021, die UN-Dekade für Menschen afrikanischer Abstammung umzusetzen. Kurz darauf bewarb sich die Stadt Kassel erfolgreich für die Teilnahme am Bundesprojekt ,Antirassismus‑Modellkommune‘ und bekräftigte damit ihre Selbstverpflichtung eine antirassistische Kommunalpolitik umzusetzen. Kassel ist auch eine Stadt, deren Bürgermeisterin sich gerne als „Bürgermeisterin für Chancengleichheit“ bezeichnet.
Zweifel an der Ernsthaftigkeit dieser Vorgaben sowie am Willen, demokratisch gefasste Beschlüsse zur Bekämpfung von Anti-Schwarzer Rassismus wirklich umzusetzen, erscheinen jedoch berechtigt – andernfalls wären Kinder in Lisas Situation solchen schmerzhaften Erfahrungen nicht schutzlos ausgeliefert. Chancengleichheit und Antirassismus sind keine Begriffe zur Dekoration von Wahlplakaten und keine Etiketten für symbolische Aktionen. Sie müssen Anspruch und Verpflichtung zugleich sein – dauerhaft, konsequent und messbar.
Die Zweifel verdichten sich: Im Kasseler Rathaus wurde offenbar gezielt darauf hingearbeitet, eine zulässige Eingabe abzuweisen – obwohl sie auf die nachhaltige Stärkung von Lisa und vielen anderen Kindern mit ähnlichen Erfahrungen abzielte. Zwischen dem, was offiziell vorgegeben wird, und dem, was tatsächlich geschieht, klafft hier wohl eine frappierende Lücke. Dieses Vorgehen wirft zudem grundlegende Fragen zum Demokratieverständnis der verantwortlichen Entscheidungsträger:innen auf. Ihnen fehlt offenbar nicht nur die grundlegende Perspektive jener, die vom Kolonialrassismus negativ betroffen sind, mit diesem Vorgehen verweigern sie auch zahlreichen Kindern mit ähnlichen Erfahrungen wie Lisa die Anerkennung ihrer Lebensrealität.
Wann wird die Stadt Kassel ihren eigenen Ansprüchen endlich gerecht – und erfüllt ihre selbst formulierten antirassistischen Verpflichtungen? Zulässige Eingaben sind Ausdruck demokratischer Teilhabe und müssen rechtskonform sowie transparent bearbeitet werden. Schon der bloße Eindruck, dass offizielle Beschlüsse und öffentliche Bekenntnisse nicht mit dem tatsächlichen Regierungshandeln übereinstimmen, untergräbt das Vertrauen in demokratische Institutionen und verschärft die gesellschaftliche Spaltung.
04.08.2025
Beitrag des mittendrin Autors Thomas Hunstock
Herr Hunstock ist Mitorganisator der Initiative emPowerKidS
Bild: Thomas Hunstock und ChatGPT


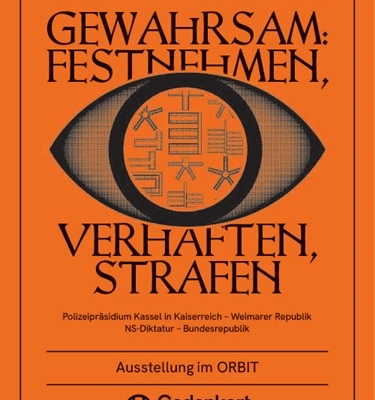 Initiative Gedenkort Polizeipräsidium Königstor
Initiative Gedenkort Polizeipräsidium Königstor